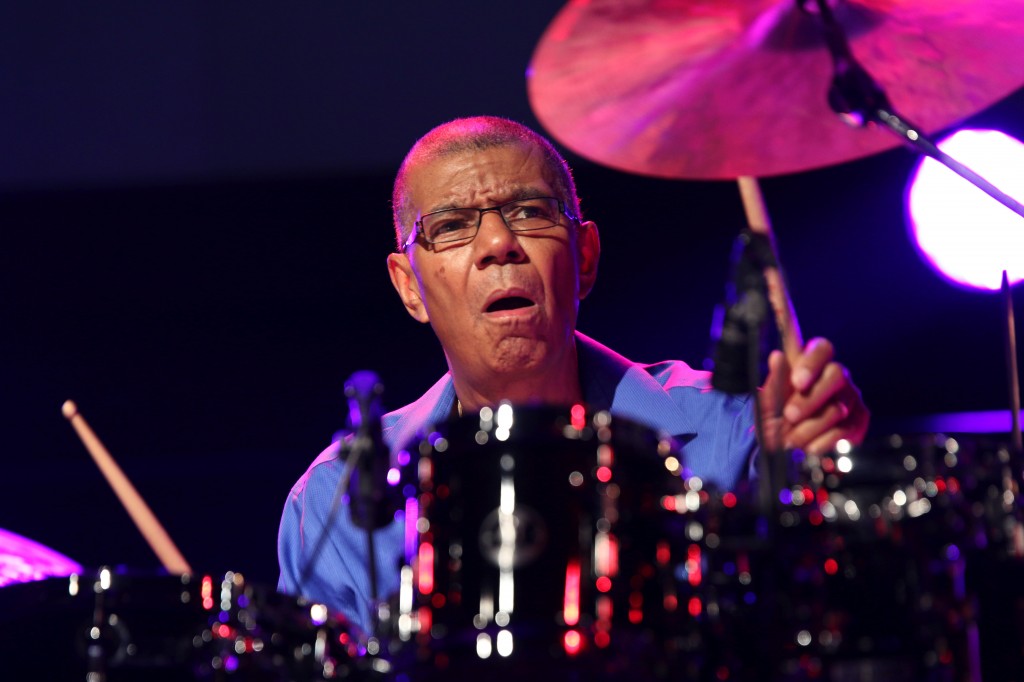Christian Baron hat es geschafft. Als erster Spross seiner pfälzischen Arbeiterfamilie hat er nicht nur das Abitur erreicht, sondern auch erfolgreich Politikwissenschaften, Soziologie und Germanistik studiert. Derzeit arbeitet der 31jährige Autor als Feuilletonredakteur bei der überregionalen linken Tageszeitung „Neues Deutschland“.
Wer so einen Weg absolviert, hat viel zu erzählen. Auch deswegen hat Baron ein Buch geschrieben. „Proleten, Pöbel, Parasiten – warum die Linken die Arbeiterklasse verachten“ lautet der Titel. Es beginnt mit der Geschichte von „Modernisierungsverlierern“ in seiner Heimatstadt Kaiserslautern, die durch den Niedergang des einst führenden Nähmaschinenherstellers Pfaff aus dem Arbeitsleben geschleudert wurden und keinen Anschluss mehr fanden. Menschen, die Jahrzehnte in unsanierten Bruchbuden leben mussten, weil der Preis für bessere Wohnungen im Arbeitslosengeld oder später im Hartz-IV-Regelsatz nicht vorgesehen ist. Es ist eine kulturelle Lebenswelt, in der teilweise viel getrunken wird, in der ein schwächelnder Fußballklub und das nachmittägliche TV-Programm eine recht große Rolle spielen. In der es aber auch eine sehr spezielle Form vom Empathie und Gemeinschaft gibt.
An der Universität Trier lernte Baron eine andere Welt kennen, und schnell wurde ihm deutlich, dass er nicht „dazu gehört“, denn “nur denjenigen, deren Eltern (..) zumindest eine solide bürgerliche Herkunft führen., öffnet diese Gesellschaft den Schlagbaum“, schreibt Baron. Wenn zu Hause nicht nur das Geld für Nachhilfe fehle und die Eltern ab der 8. Klasse nicht mehr in der Lage seien, bei den Hausaufgaben zu helfen, dann „schmeißt man schnell demotiviert die Flinte ins Korn“.
An der Uni merkt Baron alsbald, dass Menschen auch in linken Gruppen sozial sanktioniert werden, wenn sie mit „dem gebildeten Gehabe“ nicht mithalten und mit den postmateriellen Diskursen nichts anfangen können. Genüsslich beschreibt Baron die Reaktionen seiner Kommiltonen, wenn er seiner Leidenschaft für Pommes, Bratwurst und Tiefkühlpizza frönt oder in einer „Volxküche“ den Debatten über die Bedeutung von Erich Mühsam nicht folgen kann. Und während man sich in diesen Kreisen gerne für jede auch noch so obskure Befreiungsbewegung irgendwo in der Welt engagiert, selbstverständlich „bio“ und „fairtrade“-Produkte kauft und das „*“ bzw. das Binnen-I als wesentliche Elemente des Kampfes für Gerechtigkeit propagiert, werden die realen sozialen Schranken in unserer Gesellschaft gerne ausgeblendet. Es sei, so Baron, eben ein Unterschied, ob man vermeintlich linke Politik an der Uni betreibe und prekäre Jobs in Kauf nehme, weil man im Bewusstsein einer auskömmlichen Erbschaft lebe, oder ob man zur Klasse der Besitzlosen gehöre.
Die Kultur der „Unterschichten“ wird verachtet und wenn überhaupt als Event auf Trash-Partys mit Jogginghosenzwang und Besäufnissen in Proletenkneipen zelebriert. Man setzt sich ab, hört Independent-Music und später vielleicht Jazz und Klassik statt Schlager, Heavy Metal oder Soft-Rock. Man macht Individualtrips statt Pauschalreisen, meidet „Mainstream-Klamotten“. Später nennt man seine Kinder Eleonore-Sophie oder Joshua und keinesfalls Kevin oder Mandy. Man schafft sich Distinktionsmerkmale, und das alte linke Zerrbild des klassenkämpferischen Arbeiters mit roter Fahne ist dem neuen des „verwahrlosten Unterschichts-Heinis mit Wampe“ und rassistischen Sprüchen gewichen. Und wenn sich mal eine Fachtagung mit Themen wie dem Zugang unterer Schichten zur Hochkultur wie. z.B. Theater beschäftigen, dann „reden Akademiker über Nichtakademiker wie Biologen über Amöben, als läge es an der kollektiven Dummheit des Pöbels und und nicht an der strukturellen Ausrichtung des Theaters, wenn immer weniger Menschen sich für diese Kunst begeistern.“

Für Baron spiegeln sich diese Haltungen auch in der Flüchtlingsdebatte wider. Auch in linken Kreisen würden soziale Ängste, die durch den Zuzug von vielen Flüchtlingen befördert werden, pauschal als „Rassismus“ diffamiert. Zitiert wird der Publizist Raul Zelik, der im April 2016 im Neuen Deutschland schrieb: „Für die Putzkraft oder den ungelernten Arbeiter auf dem Bau erhöht Zuwanderung den Druck auf das Lohnniveau. Für den urbanen Akademiker, der trotz seiner Projekt-Prekarität eigentlich ganz gut über die Runden kommt, stellt Migration dagegen sicher, dass die frisch zurbereitete Kokos-Tofu-Suppe im Schnellrestaurant auch in Zukunft für fünf Euro zu haben ist. Und auch im Segment der Medienkreativen wird die Konkurrenz durch Zuwanderer überschaubar bleiben“. Aber „solange die Linken es unterlassen, die soziale Frage mit der Flüchtlingspolitik explizit zu verbinden , so lange werden die Unterschicht und die verängstigte Mitte einen großen Bogen um sie machen“ schreibt Baron und leitet daraus Positionen zu „Multikulturalismus“ und zum Islam ab, die ihm in seinem politischen Umfeld wenig Freunde bescheren werden. .Es gehe eben nicht nur um Toleranz und Integrationsbereitschaft. Natürlich sei es inakzeptabel, den Islam pauschal als Bedrohung zu dämonisieren, aber man müsse zur Kenntnis nehmen, „dass viele Flüchtlinge einer repressiven politischen Ökonomie entstammen, die auf sozialer Ungleichheit, Frauenverachtung, Homophobie und Todestrafen fußt“. Aber dies werde in linken Diskursen meistens ausgeblendet. Das gelte auch generell für Religionskritik, obwohl die Linke eigentlich in einer säkularen Tradition stehe. Beängstigend sei, „dass mittlerweile jeder von Linken als „antimuslimischer Rassist“ beschimpft wird,, der generell gegen jeden verpflichtenden Religionsunterricht (also auch muslimischen) an staatlichen Schulen eintritt (..) oder die rituelle Beschneidung kleiner Kinder als Gewaltanwendung versteht“.
Immer wieder kehrt Baron in seinem Buch in seine Heimatstadt zurück, in die „Unterschicht-Milieus“ denen er sich – anders als viele Aufsteiger – eben nicht entfremdet hat. Er beschreibt freundliche, manchmal fröhliche Menschen, die viele Zweifel und Fragen haben, mit denen man aber über alles reden kann – wenn man sie akzeptiert. Mit Ausführungen über Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci oder Gender Mainstreaming könne man Menschen, für die eine defekte Waschmaschine ein existentielles Problem darstellt, aber nicht kommen. Den einzigen Weg, den Vormarsch rechter Parteien in diesen Milieus aufzuhalten sieht Baron in einem „linken Populismus“ der an den tatsächlichen Nöten anknüpft ohne sich rassistischen und antidemokratischen Ideologien anzubiedern. Aber solange sich besonders die akademische Linke in identitätspolitischen Genderdiskursen u.ä. in ihren soziokulturellen Freiräumen verschanze, bleibe die Distanz zur bestenfalls als zu bekehrenden „revolutionäres Subjekt“ idealisierten Unterschicht unüberbrückbar.
Es ist ein spannendes, absolut lesenswertes Buch, das vor allem mit seiner Mischung aus individuellen Erlebnissen und fundierter Analyse besticht. Für mache Leser wird es – sofern sie sich darauf einlassen – ein Blick in den Spiegel sein. Für andere ein Einblick in eine fremde Welt Stoff für Diskussionen bietet es allemal.
Christian Baron
Proleten, Pöbel, Parasiten – Warum die Linken die Arbeiter verachten
Eulenspiegel Verlag, Oktober 2016
288 Seiten, 12,99 €
ISBN 978-3-360-01311-8