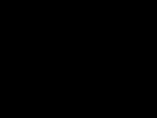Der folgende Text erschien heute in der Wochenendbeilage von “Neues Deutschland” und ist dort nur für Abonnenten abrufbar.
Das Leben in der liberalen Wohlstandsgesellschaft ist ziemlich kompliziert geworden. An jeder Ecke lauern unzählige Weggabelungen und Fallstricke, die den „bewusst lebenden“ Menschen vom Pfad der Tugend abzubringen drohen. Wer sich dem Diktat der Nachhaltigkeit widersetzt, wird bestenfalls nur belächelt oder schief angeguckt, oftmals aber regelrecht ausgegrenzt. Das informelle Regelwerk ist umfangreich, unübersichtlich und teilweise widersprüchlich. Es greift in alle Lebensbereiche ein und ist vielseitig auslegbar. So taugt Nachhaltigkeit auch hervorragend als neoliberaler Kampfbegriff, wenn es etwa um die Kürzung von Renten oder strikte Austeritätspolitik geht. Schließlich müsse man nachkommende Generationen vor hohen Staatsschulden bewahren. Auf der anderen Seite dient sie als Klammer für esoterischen Irrationalismus bis hin zur Verehrung von faschismusaffinen, rassistischen Naturphilosophen wie Rudolf Steiner, dem wir nicht nur die Waldorf-Schulen, sondern auch die biodynamische Landwirtschaft zu verdanken haben. In den urbanen Mittelschichten ist Nachhaltigkeit zum Distínktionsmerkmal geworden, in den Werbeagenturen und PR-Abteilungen zum zentralen Verbreitungs- und Vermarktungsargument für Ideologien, Produkte und Dienstleistungen.
Wer sich in diesem Sinne gründlich daneben benehmen will, hat viele Möglichkeiten. Man kann beispielsweise den Kauf von Bio-Lebensmitteln verweigern, das „Fairtrade“-Siegel konsequent ignorieren, Pauschalreisen buchen, regelmäßig Fleischprodukte zu sich nehmen, die häusliche Stromversorgung nicht aus 100% erneuerbaren Energien bestreiten, sein so genanntes Übergewicht gleichmütig zur Kenntnis nehmen und bei der Behandlung von Krankheiten auf die „Schulmedizin“ vertrauen.. Dann ist man schon ein ziemlich schlechter, nicht bewusst lebender Mensch, der sowohl an seinem eigenen Verfall, als auch am drohenden Untergang der menschlichen Zivilisation ein gerütteltes Maß Schuld trägt. Dabei sind die Verdikte zunehmend aggressiver agierender Sektenpropheten, wie z.B. Veganern und anderen Selbst- und Weltoptimierern, noch gar nicht berücksichtigt, denn da hängt die Latte noch wesentlich höher.
Die informellen Diktate der Nachhaltigkeitsideologie haben einiges gemeinsam. Sie enthalten stets ein paar Körnchen Wahrheit, aber auch jede Menge Lügen. Sie sind über kurz oder lang stets marktkompatibel und politisch in viele Richtungen instrumentalisierbar. Beginnen wir mit „bio“, sozusagen der Basisversion der bewussten Lebensführung. Die in Deutschland stetig wachsende Nachfrage nach ökologisch angebauten Lebensmitteln führt in vielen Anbauländern längst zu jenen desaströsen Monokulturen, Umwelt- und Naturzerstörungen, die durch diese Art der Landwirtschaft eigentlich überwunden werden sollten. Besonders augenfällig ist das in einigen spanischen Provinzen, wo vor allem Tomaten, Paprika, Gurken und Erdbeeren zunehmend „ökologisch“ für den deutschen Markt angebaut werden. Dieser Boom bringt den örtlichen Großbauern und den hiesigen Groß- und Einzelhändlern zwar satte Profite, aber die Böden in großen Teilen Andalusiens sind längst ausgelaugt, die Grundwasserknappheit ist dramatisch, der Blick streift nicht über Gemüsefelder, sondern über ein schier endlosen Meer von Plastikplanen. Längst kämpfen Umweltschützer gegen die neuen Megafarmen „die im Namen von bio die Natur zerstören“, wie es Marcos Diéguez von der Gruppe Ecologistas en Acción im November im „stern“ formulierte. Doch davon will der deutsche Bio-Kunde ebensowenig wissen, wie von den Arbeitsbedingungen der meist nord- und schwarzafrikanischen Saisonarbeiter, die dort für unseren „nachhaltigen Konsum“ tätig sind. Und das gilt auch für die Massentierhaltung, die in der deutschen Biobranche vor allem für die Eier- und Milchproduktion längst Standard ist.

Quelle: www.emailleschilder.com (CC BY 1.0) )
Doch man zahlt gerne einen Aufpreis für ein gutes Gefühl, denn auch in Bezug auf Qualität und Verträglichkeit lebt die Bio-Branche in erster Linie von liebevoll gepflegten Mythen. So sehen das auch ausgewiesene Kritiker der konventionellen, industrialisierten Landwirtschaft wie die Stiftung Warentest oder die Verbraucherschutzorganisation foodwatch. Es gebe „keine belastbaren Beweise, dass Bionahrung per se vorteilhafter für die Gesundheit ist”, sagte deren stellvertretender Geschäftsführer Matthias Wolfschmidt in einen Interview. Auch Geschmackstests lassen in der Breite keine Vorteile für Standardprodukte aus ökologischer Erzeugung erkennen. Natürlich gibt es Tomaten, Gurken, Kartoffeln, Möhren, Äpfel und Birnen oder auch Eier, Milchprodukte und Weine, die eindeutig besser schmecken als andere. Aber das Ökosiegel ist dafür alles andere als ein verlässlicher Indikator.
Daher hat sich in der Biobranche mittlerweile ein Edelsegment etabliert. Produkte von Verbänden wie Demeter und Bioland werden nach deutlich strengeren Kriterien zertifiziert. Sie machen aber nur einen Bruchteil des Angebots aus und sind zudem nochmals deutlich teurer. Also setzt die Branche noch einen drauf, gemäß dem Motto: „Regional ist das neue bio“. Lebensmittel aus dem Umland, mit kurzen Transportwegen und Lagerzeiten? Auch das ist wenig mehr als gefühliger Schwindel, wenn man mal von kleinen Direktvermarktern und Produkten mit offiziell zertifizierter geschützter geografischer Herkunftsangabe absieht. Der Begriff regional ist gesetzlich nicht definiert. Bei verarbeiteten „regionalen“ Produkten können die Rohstoffe von sonstwoher kommen, und auch die Milch von der „regionalen“ Molkerei hat oft sehr weite Wege hinter sich. Bei Obst und Gemüse ist es auch mit dem oft zitierten „ökologischen Fußabdruck“ nicht so gut bestellt, wie es der „bewusste“ Käufer gerne hätte. Der monatelang im Kühlhaus gelagerte Apfel von nebenan hat auf seinen Lebensweg zum Käufer im Frühjahr jedenfalls deutlich mehr Energie verbraucht als ein saisonal geernteter Importapfel aus anderen Teilen der Welt.
Natürlich will fast niemand auf Produkte aus fernen Ländern vollständig verzichten. Ein Asketismus, der den Verzicht auf Kaffee, Tee, Bananen, Mangos, Pfeffer, Reis u.v.a.m. beinhaltet, ist selbst unter ausgewiesenen Freunden von „Nachhaltigkeit“ und „Regionalität“ nur eine marginale Randerscheinung. Für den perfekten Selbstbetrug gibt es in diesen Fällen das „Fairtrade“-Label. Dies suggeriert eine hohen moralischen Anspruch. „Faire“ Preise für die Erzeuger, die damit die Lebensbedingungen der Arbeiter vor Ort verbessern, beispielsweise durch höhere Löhne, den Bau von Wohnungen Schulen und die Gewährleistung medizinischer Versorgung. Auch hier gilt: Man zahlt seinen Ablass für ein gutes Gewissen und guckt lieber nicht etwas genauer hin. Dokumentiert sind etliche Fälle in Lateinamerika und Afrika, wo selbstversorgende Kleinstbauern vertrieben wurden, um Platz für lukrative, exportträchtige „Fairtrade“ -Monokulturen zu schaffen. Auf den Bildern von glücklichen Kindern, die jetzt dank „fairtrade“ eine Lehmhütte als Schulgebäude haben, ist davon leider nichts zu sehen. Auch ist es den Betrieben erlaubt, nur einen Teil ihrer Produktion zu zertifizieren bzw. bei verarbeiteten Produkten muss für das begehrte Siegel nur ein bestimmter Teil der verwendeten Rohstoffe aus „fairer“ Herstellung kommen. Ein schönes Beispiel für diesen Etikettenschwindel schilderte vor zwei Jahren die Verbraucherzentrale Hamburg. Ein Eiskaffeehersteller schraubte seinen Anteil an fair gehandelter Ware von sechs auf 60 Prozent hoch, indem er bei den Zutaten das Wasser und den Wasseranteil der Milch heraus rechnete. Ohnehin kommt von dem beträchtlichen Aufpreis, der hier für „Fairtrade“-Produkte gezahlt wird, nur ein Bruchteil bei den Produzenten an, der Rest landet bei Zertifizierungsstellen und in Form von Extraprofiten bei Groß- und Einzelhändlern.
Allerdings geht der Nachhaltigkeitsschwindel nicht nur durch den Magen. Individualreisende und Ökotouristen in fernen Gefilden sorgen in ihrer Gesamtheit zumindest mittelfristig für ähnliche soziale und ökologischer Verwerfungen wie die Nutzer von Bettenburgen auf Malle und den Malediven. Die Sinnlosigkeit des Bezugs von teurem Ökostrom sollte angesichts der Ausweitung der Kohleverstromung in Deutschland eigentlich auf der Hand liegen, vom europäischen Stromverbund ganz zu schweigen.
All dieser und vergleichbarer Humbug wäre vernachlässigenswert – wenn er nicht mit dem Impetus der moralischen Überlegenheit zelebriert würde. Oder gar mit der Überzeugung, dass man schließlich „etwas tut“ für die soziale und ökologische Zukunft der Menschheit. Dabei müssten wir tatsächlich „etwas tun“, nämlich gesellschaftliche Rahmenbedingungen für nachhaltige Entwicklung im umfassenden Sinne zu schaffen. Mit dem Kassenzettel vom Biomarkt als Ablassquittung und der Fairtrade-Banane auf dem Obstteller kommt man in dieser Hinsicht jedenfalls keinen Schritt weiter. Also lasst uns gefälligst unbehelligt essen und trinken, was uns schmeckt und preislich angemessen erscheint, Geld bei der Wahl des Stromanbieters sparen, den Urlaub verbringen, wie wir es mögen und dabei auch ganz viel Unvernünftiges tun.